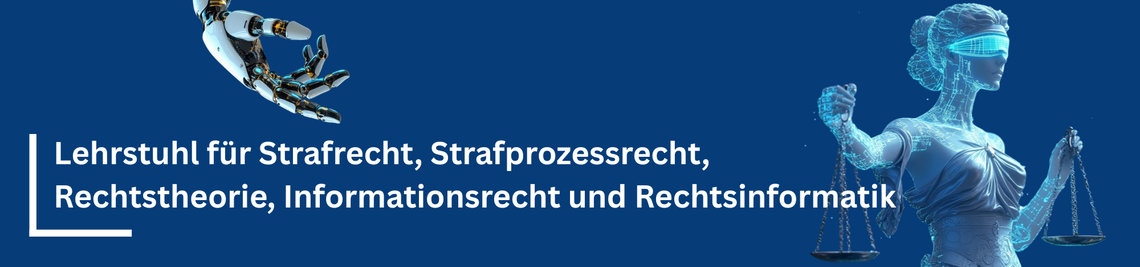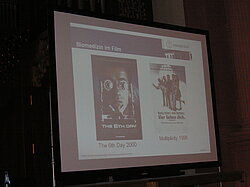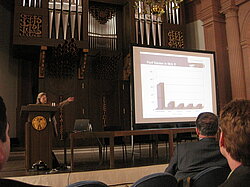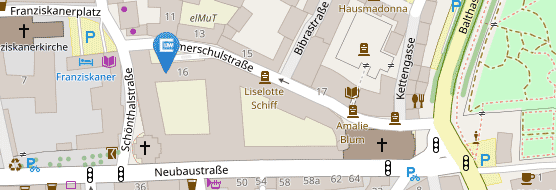Frühere Projekte
Das Projekt:
Das mittlerweile europäisch geprägte deutsche Recht ist in vielen Teilen der Welt verbreitet und wird zurecht vom BMJ mit dem Qualitätslabel Law Made in Germany bezeichnet. Dies beruht nicht zuletzt auf der besonderen Orientierung des deutschen Rechts an den Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Sozialstaatlichkeit.Im Zuge der Globalisierung spielt das Recht als Standortfaktor auch für Unternehmen eine entscheidende Rolle. Eine weite Akzeptanz rechtstaatlicher Grundsätze ist hierbei günstig, weil so die Rechtslage in den Zielmärkten transparent und im Prinzip berechenbar wird. Trotz mancher Erfolge erscheinen die Bemühungen zur Verbreitung deutschen Rechts verbesserungsfähig und es ist die bisher vernachlässigte Aufgabe der Außenwissenschaftspolitik des Rechts, diese zu fördern. Die Frage einer Außenwissenschaftspolitik ist auch international gesehen wichtiger denn je. Globale Fragen wie der Klimawandel, die Rohstoffversorgung aber auch die Themen Flucht und Migration, zuletzt nicht nur in Anbetracht der sog. Flüchtlingskrise 2015/16 und dem verheerenden Brand in dem griechischem Flüchtlingslager Moria fordern Antworten, die insbesondere auf dem Gebiet der Rechtswissenschaft bisher fehlen.
Mitglieder/Unterstützer:
• Dr. Tilo Klinner
Dr. Klinner ist Jurist und war langjähriger Beamter im Auswärtigen Dienst der Bundesrepublik Deutschland. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Würzburg, Lausanne und Montreal sowie der Promotion trat er 1988 in den diplomatischen Dienst ein. Seine beruflichen Stationen umfassten u. a. Tätigkeiten in der Zentrale des Auswärtigen Amts sowie an verschiedenen deutschen Auslandsvertretungen, darunter Moskau, Peking, Karachi und Astana. Von 2021 bis 2024 war er Botschafter in Usbekistan. Seine Arbeitsschwerpunkte lagen im Bereich der internationalen Wirtschafts- und Technologiepolitik sowie in der Öffentlichkeitsarbeit.
• Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf
Prof. Hilgendorf ist Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtstheorie, Informationsrecht und Rechtsinformatik an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Er studierte Philosophie, Geschichte und Rechtswissenschaft in Tübingen und wurde sowohl im Bereich Philosophie als auch im Strafrecht promoviert. 1996 habilitierte er sich und lehrt seit 2001 in Würzburg. Seine Forschungsschwerpunkte liegen u. a. im Bereich des Medienstrafrechts, der Rechtsphilosophie und des Europäischen Strafrechts. Darüber hinaus ist er in verschiedenen wissenschaftlichen Gremien aktiv.
Publikationen und Literatur:
Hilgendorf, Eric: Von der juristischen Entwicklungshilfe zum Rechtsdialog in: FS Roxin, Bd. 2, S. 1451–1463.
Hilgendorf, Eric: Die ausländische Strafrechtswissenschaft in Selbstdarstellung, Berlin 2019.
Hilgendorf, Eric: Die deutschsprachige Strafrechtswissenschaft in Selbstdarstellung, Berlin 2010.
Schütte, Georg: Wettlauf ums Wissen. Außenwissenschaftspolitik im Zeitalter der Wissensrevolution, Berlin 2008.
Schütte, Georg: Außenwissenschaftspolitik, in: Simon, Dagmar et al. (Hsrg.): Handbuch Wissenschaftspolitik, 2010.
Kirste, Stephan (Hrsg.): Interdisziplinarität in den Rechtswissenschaften, Berlin 2016.
Globale System Interkultuturelle Kompetenz (GSiK-Jura)
Das Projekt „Globale Systeme und Interkulturelle Kompetenz“ des Lehrstuhls Hilgendorf widmete sich der Auseinandersetzung mit interkulturellen Fragestellungen im juristischen Kontext. In einer zunehmend globalisierten Welt, in der Kontakte zu unterschiedlichen Kulturen zum Alltag gehören, stellte das Projekt eine gezielte Antwort auf die wachsenden Herausforderungen im Umgang mit kultureller Vielfalt dar – etwa im Zusammenhang mit Themen wie Ehrenmorden, religiösen Symbolen im öffentlichen Raum, Migration oder interkulturellen Konflikten im Rechtssystem.
Ziel des Projekts war es, angehenden Juristinnen und Juristen grundlegende interkulturelle Kompetenzen zu vermitteln – eine Schlüsselqualifikation des 21. Jahrhunderts. Hierfür wurde ein vielfältiges Lehrangebot bestehend aus Seminaren, Workshops und Vorträgen geschaffen, das Studierende zu einer offenen, differenzierten und rationalen Auseinandersetzung mit interkulturellen Themen einlud. Die Veranstaltungen regten zur eigenständigen Recherche und kritischen Meinungsbildung an, fernab von vorgefertigten Positionen.
Nach dem Besuch von fünf Veranstaltungen und dem Bestehen einer Klausur im Rahmen des vhb-Kurses „Interkulturalität, Ethik und Recht“ konnten die Teilnehmenden ein Zertifikat erwerben, das ihr Engagement im Bereich interkultureller Kompetenz dokumentierte. Der Kurs vermittelte das nötige Rüstzeug für ein grundlegendes Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Recht und Kultur und bereitete zugleich auf das juristische Staatsexamen vor.
Darüber hinaus bot das Projekt besonders engagierten Studierenden die Möglichkeit, sich aktiv im Rahmen des studentischen Arbeitskreises einzubringen, eigene Themenvorschläge einzureichen und Veranstaltungen gemeinsam mit dem GSiK-Jura-Team zu gestalten.
Das Projekt wurde inzwischen abgeschlossen und gehört nun zu den frühen Initiativen im Bereich interkultureller Bildung.
Am 20. April 2023 besuchte die bayerische Staatsministerin für Digitales, Judith Gerlach, MdL, die Juristische Fakultät der Universität Würzburg.
Empfang und Begrüßung durch den Studiendekan
Der Studiendekan Professor Dr. Frank Schuster begrüßte die Ministerin bei ihrer Ankunft um 17 Uhr im Innenhof der Alten Universität.
Der Besuch der Ministerin fiel in die Erstsemesterwoche, ein von den Juristen Alumni Würzburg entwickeltes Angebot des Studiendekanats, das Studierenden zu Beginn ihres Studiums eine Vielzahl von Einführungs- und Informationsveranstaltungen bietet. Im Rahmen der Erstsemesterwoche veranstaltet die Fachschaft auch eine Rallye, bei der die Studierenden an Minispielen an vielen unterschiedlichen Stationen in der Würzburger Innenstadt teilnehmen.
Zum Anlass des Besuchs der Digitalministerin kooperierten die Fachschaft und die Juristen Alumni Würzburg e.V., um die Ersti-Rallye erstmals als Digital-Rallye durchzuführen. Hierzu führte die Fachschaft zusätzlich ein Bingo durch, für dessen Gewinner:innen die Juristen Alumni Preise finanzierte.
Eröffnung der Ersti-Rallye durch die bayerische Digitalministerin
Im Rahmen der Eröffnungsrede der Ministerin zur Rallye erzählte sie den neugierigen Studierenden im ersten Semester von Ihrer Studienzeit und der Wichtigkeit einer gesunden „Study-Life-Balance“.
Einleitung durch den Studiendekan in der Neubaukirche
Im Anschluss wurden die Studierenden zur Digital-Rallye entlassen und der Besuch der Ministerin verlagerte sich in die Neubaukirche. Nach einleitenden Worten des Studiendekans Professor Dr. Frank Schuster stellte die Staatsministerin die erst kürzlich vorgestellte bayerische Digitalstrategie vor.
Aufgrund des Umfangs des Digitalplans Bayern über 200 Maßnahmen, konnte die Ministerin selbstverständlich nicht auf alle Punkte eingehen. Sie nannte jedoch insbesondere das Modellprojekt des bereits erfolgreichen Digitalen Werkzeugkastens für Kommunen, der noch weiter ausgebaut wird, um die Zusammenarbeit der Kommunen mit Unternehmen und Bürgern zu verbessern. Dazu sollen die sogenannten BayernPackages treten, mit denen der Freistaat ein Paket von betriebsbereiten, sofort einsetzbaren Online-Diensten liefert, damit bis Ende 2024 alle relevanten Verwaltungsleistungen allen Bürgern und Unternehmen online zur Verfügung stehen. Besonders hob Frau Gerlach die Stärkung der digitalen Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hervor. Denn von Bund, Ländern oder Kommunen bereitgestellte digitale Dienste benötigen stets Personal, das auch mit diesen umgehen können muss.
Nach der Vorstellung des Digitalplans gab es die Möglichkeit für Fragen an die Digitalministerin. Die Themen reichten von nicht funktionierendem WLAN in Universitätsgebäuden zu spezifischen Fragen in der Umsetzung der angekündigten über 200 Maßnahmen.
Vortrag von Professor Hotho zur Digitalisierung an der Universität Würzburg
Auf den Vortrag von Frau Gerlach folgte ein Einblick von Professor Hotho (Lehrstuhl für Informatik X und Sprecher von CAIDAS) in die Digitalisierung und Digitalisierungsbemühungen der Universität Würzburg.
Wahrheit und Richtigkeit im Prozess und im Strafrecht: Philosophische und rechtsdogmatische Perspektiven (Laufzeit: Juli 2019 – August 2022)
Das Projekt widmete sich zentralen Begriffen der Rechtsanwendung und -auslegung: Wahrheit und Richtigkeit im Kontext des Strafrechts. Ziel war es, diese Konzepte sowohl aus philosophischer als auch aus rechtsdogmatischer Perspektive zu beleuchten und ihre Bedeutung für das Strafverfahren und die richterliche Entscheidungsfindung kritisch zu reflektieren.
Obwohl ursprünglich Veranstaltungen während der gesamten Projektlaufzeit vorgesehen waren, musste der für März 2020 geplante Workshop pandemiebedingt entfallen. Ein zentrales Ereignis des Projekts konnte jedoch im Juli 2022 nachgeholt und zugleich in eine internationale Tagung eingebettet werden: Vom 28. bis 30. Juli 2022 fand an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg die Veranstaltung „Strafrechtswissenschaft in Deutschland, Lateinamerika und Spanien“ statt. Organisiert wurde sie von Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf (Würzburg) in Kooperation mit Prof. Dr. Luis Emilio Rojas (Universidad Alberto Hurtado) und mit Unterstützung der Alexander von Humboldt-Stiftung sowie des Juristen Alumni Würzburg e.V.
Im Zentrum der dreitägigen Tagung stand der internationale wissenschaftliche Austausch zu grundlegenden Fragen des Strafrechts. Den Auftakt bildete der Workshop „Wahrheit und Richtigkeit im Recht – philosophische Perspektiven der Rechtspflege“, bei dem renommierte Wissenschaftler wie Prof. Dr. Dr. Marcelo Sancinetti (Buenos Aires), Leandro Dias, LL.M., und Lucila Tuñón, LL.M., mit Beiträgen zu Themen wie Falschaussage, richterlicher Rechtsbeugung oder moralischer Wahrheit vertreten waren.
Am zweiten Tag wurde im Rahmen eines Festakts die Festschrift „Brücken bauen“ zu Ehren von Prof. Dr. Dr. h.c. Marcelo Sancinetti überreicht. Der Festvortrag von Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang Frisch widmete sich der Geschichte und Problematik der objektiven Zurechnungslehre.
Abgerundet wurde die Tagung durch eine zweitägige wissenschaftliche Werksbesichtigung zu Ehren von Prof. Dr. Dr. h.c. Jesús-María Silva Sánchez, bei der zahlreiche Expertinnen und Experten aus Deutschland, Lateinamerika und anderen Ländern seine Beiträge zur Strafrechtswissenschaft analysierten und diskutierten.
Das Projekt förderte den internationalen fachlichen Austausch und eröffnete neue Perspektiven auf grundlegende Fragestellungen des Strafrechts.
10.05.
14:00 Uhr: Stadtführung
(bei Interesse)
Treffpunkt:
Vor der Alten Universität Domerschulstraße 16
18:00 Uhr: Begrüßung im Hörsaal I
18:15 Uhr: Die Regulierung des Lebensendes als rechtliche Herausforderung
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Albin Eser, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht Freiburg
Anschließend Empfang
11.05.
ab 08:00 Uhr: Registrierung
09:00 Uhr: Tagungseröffnung
09:15 Uhr: Sterbehilfe in Deutschland. Die Perspektive der Strafrechtswissenschaft
Jun.-Prof. Dr. Elisa Hoven, Universität zu Köln
10:30 Uhr: Zur Entwicklung der Palliativ- und Hospizmedizin: Blick aus der Praxis
Dr. med. Rainer Schäfer, Chefarzt des Julius-Spitals Würzburg
11:45 Uhr: Mittagpause
14:00 Uhr: Der rechtliche Rahmen der Palliativ- und Hospizmedizin
Prof. Dr. Volker Lipp, Georg-August-Universität Göttingen
15:15 Uhr: Patientenautonomie am Lebensende
Prof. Dr. Dr. h.c. Jan C. Joerden, Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder
16:30 Uhr: Kaffeepause
17:00 Uhr: Zum Einsatz von Robotern im Palliativ- und Hospizbereich
Prof. Dr. Susanne Beck, Leibniz-Universität Hannover
18:15 Uhr: Besprechung der Medizinrechtslehrerinnen und –lehrer
19:00 Uhr: Weinprobe und Abendessen
12.05.
09:00 Uhr: Übertherapie – Ursachen und Lösungsansätze
Prof. Dr. Constanze Janda, Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer
10:15 Uhr: Die Schweizer Perspektive – Patientenverfügungen und Entscheidbefugnisse am Lebensende
Prof. Dr. Regina Aebi-Müller, Universität Luzern I
11:30 Uhr: Mittagspause
14:00 Uhr: Sterbehilfe: Die Sicht der Theologie
Prof. Dr. Hartmut Kreß, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
15:15 Uhr: Debatte: Zur Zukunft der Sterbehilfe
Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Birnbacher, Universität Düsseldorf
Prof. Dr. Gunnar Duttge, Universität Göttingen
Moderation: Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf
16:15 Uhr: Ende der Veranstaltung
17:00 Uhr: Gemeinsamer Ausflug nach Veitshöchheim
Das Projekt „Würzburg Summer School 2018 – Digitalization and Law“ war eine vom Lehrstuhl von Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf organisierte internationale Summer School, die vom 30. Juli bis 3. August 2018 an der Universität Würzburg stattfand. Inhaltlich befasste sich die Veranstaltung mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf das Recht, insbesondere auf das Strafrecht. Zentrale Vorträge hielt Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf zu Themen wie Law and Innovation, Internet Yesterday, Today, and Tomorrow, Automated Industry, Autonomous Cars und Robots – Our New Partners!?. Weitere Beiträge stammten unter anderem von Dr. Karin Linhart zur Einführung in das deutsche Rechtssystem, Prof. Dr. Sancinetti (Argentinien) sowie Roger Fabry zum Case Law System. Ergänzt wurde das Programm durch Präsentationen der Teilnehmenden, einen schriftlichen Abschlusstest und ein begleitendes Rahmenprogramm.
Das Kompetenzzentrum Digitalisierung und Recht (KDR) wurde 2018 am Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtstheorie, Informationsrecht und Rechtsinformatik von Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf gegründet. Es richtete sich direkt an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aus Nordbayern, indem es praxisrelevante Probleme an der Schnittstelle zwischen Digitalisierung und Recht in den Fokus nimmt. Das Kompetenzzentrum wurde zum Teil durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert und nahm an dem Projekt MA-Netze-DiReKT der Juristischen Fakultät teil.
Digitalisierung verändert unser aller Leben. Das Tempo der Veränderungen und die Bedeutung, die diese Veränderungen für unsere gesamte Lebens- und Arbeitswelt haben, sind historisch wohl beispiellos. Es ist deshalb von überragender Wichtigkeit, dass die Technik auch in Zukunft dem Menschen dient und nicht umgekehrt.
Die Verteidigung dieser grundlegenden Human- und Gemeinwohlorientierung der Technik ist nicht zuletzt Aufgabe des Rechts. Es soll die technologische Entwicklung zähmen und in geordneten Bahnen halten. Dabei sind sämtliche Teilgebiete der Rechtsordnung von Bedeutung: Die verfassungsrechtlichen Grundlagen, insbesondere die Menschenwürde und die Grundrechte, das zivilrechtliche Haftungsregime mit Verschuldens- und Gefährdungshaftung, das Strafrecht als schärfste Waffe des Staates zur Verteidigung überragend wichtiger Rechtsgüter, aber auch das Datenschutzrecht, das Straßenverkehrsrecht, das Versicherungsrecht und viele andere Rechtsgebiete mehr.
Bereits im Jahr 2010 wurde vor diesem Hintergrund an der Juristischen Fakultät der Universität Würzburg die Forschungsstelle RobotRecht gegründet. Diese hat es sich zur Aufgabe gemacht, die einschlägigen Rechtsfragen in enger Kooperation mit Disziplinen wie der wissenschaftlichen Technikfolgenabschätzung, den Ingenieurwissenschaften, der Ethik und der Ökonomie zu erforschen.
Das neue Kompetenzzentrum Digitalisierung und Recht soll die Ergebnisse dieser Arbeit allgemeinverständlich aufbereiten und einer breiteren Öffentlichkeit vermitteln. Unser Fokus liegt dabei auf der Wirtschaft Mainfrankens: Das Kompetenzzentrum richtet sich direkt an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aus Nordbayern, indem es praxisrelevante Probleme an der Schnittstelle zwischen Digitalisierung und Recht in den Fokus nimmt. Im Rahmen von Vorträgen, Workshops und Arbeitsgruppentreffen werden die Teilnehmer für die juristischen Problemfelder der Digitalisierung sensibilisiert und bekommen Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt, die sie auf ihr einzelnes Unternehmen übertragen können.
Im Rahmen des Projekts fanden fünf Veranstaltungen in den Jahren 2018 und 2019 statt.
Am 19.07.2018 war die Auftaktveranstaltung mit dem Titel "Rechtliche Herausforderungen für kleine und mittlere Unternehmen", bei der Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf zunächst das Kompetenzzentrum vorstellte. Im Anschluss referierte Nicolas Woltmann zu "Praxisprobleme selbstlernender Systeme" und Paul Vogel zum Thema "EU-DSGVO: Herausforderungen für KMU".
Am 01.10.2018 fand ein Workshop zum Thema "Ethik und Recht im Bereich Künstlicher Intelligenz" statt. Im Workshop sollten einzelne Problemfelder im Bereich KI identifiziert, analyisiert und im Anschluss gemeinsam potentielle Lösungskonzepte erarbeitet werden.
Da nach der Auftaktveranstaltung zahlreiche Einzelfragen in Bezug auf Digitalisierungsvorgänge in Arztpraxen und Krankenhäusern eingingen, fand am 10.01.2019 ein Workshop zu den rechtlichen Aspekten der Digitalisierung in Arztpraxen statt. Schwerpunkt der Veranstaltung war das Datenschutzrecht, was anhand eines Fragenkatalogs von den beiden wissenschaftlichen Mitarbeitern Dr. Severin Löffler und Paul Vogel vorgestellt wurde.
Am 14. und 15. März 2019 folgte die internationale Konferenz "Digitization, Artificial Intelligence and Law" im Toskana-Saal der Residenz. Informationen zur Tagung sind auf der Seite der Forschungsstelle RobotRecht zu finden.
Am 14.10.2019 fand der Themennachmittag "Ethik und Recht autonomer Systeme". Dabei gab es Vorträge zum "Rechtsrahmen autonomer Systeme" von Eric Hilgendorf, Anna Lohmann und Annika Schömig, "Philosophische Aspekte von Software-Agenten" von Julian Nida-Rümelin und Antonio Bikić, "Die Technik im autonomen Auto: Ein Blick in die Gegenwart" von Alexandra Kirsch und Adriano Mannino und im Anschluss eine Podiumsdiskussion.
Der VHB-E-Learning-Kurs „Interkulturalität, Ethik und Recht“ (ab WS 2014/15) – Innovatives und flexibles Lernen „along the way“
Die Grundprinzipien:
1. Studieren am Puls der Zeit
Der Kurs widmet sich einem alltagsnahen und hochaktuellen Themenbereich.
2. Interdisziplinarität:
Neue Perspektiven bereichern. Ein regelmäßiger Blick „über den Tellerrand“ der eigenen Fachdisziplin bringt nicht nur Abwechslung ins Studium, sondern wirkt auch Fachidiotie entgegen.
3. Flexibilität & Individualität:
Der Kurs lässt sich am PC/ Laptop oder auch über ein Tablet oder Smartphone bearbeiten. Tageszeit, Ort und Dauer der Kursbearbeitung können nach eigenen Lernbedürfnissen festgelegt werden – ob 15min zwischendurch im Bus, in der Uni-Bibliothek oder abends gemütlich auf Ihrem Sofa, entscheiden Sie selbst.
Tipp für Würzburger Studenten: Hier kann kostenlos „gesurft“ werden:
- Café im Max-Stern-Keller (Alte Universität)
- Uni Café
- Café Jenseits
- Zaubergarten
- Chelsea
- Café zum schönen René
- Markt 7
- Marienplatz
Worum geht es im Kurs?
Bei Kultur, Ethik und Recht handelt es sich um Konzepte, denen in unserer globalisierten Lebenswelt auf vielfältige Weise Relevanz zukommt. Die im Schnittstellenbereich bestehenden Wechselwirkungen sind mannigfaltig und uns im alltäglichen Handeln oftmals nicht bewusst. Was wir moralisch als Recht und Unrecht empfinden, steht in unmittelbarem Zusammenhang mit unserer sozio-kulturellen Prägung.
Doch nicht nur das subjektive Rechtsempfinden, sondern auch das geschriebene Recht ist ein „Kulturphänomen“. Seine Interpretation, Auslegung und Weiterentwicklung lassen sich stets auf kulturelle Werte zurückführen – kurzum: Recht ist Kultur. Sind wir ausschließlich mit unserem eigenen Rechtssystem vertraut, können wir das Ausmaß seiner kulturellen Bedingtheit nur schwer erkennen (vgl. Schroll-Machl 2007). Solche „blinden Flecken“ in unserer individuellen Wahrnehmung können vor allem in der (interkulturellen) Berufspraxis fatale Folgen haben – im juristischen Kontext etwa im Rahmen eines Gerichtsprozesses.
Erst die Auseinandersetzung mit dem „Anderen“ und „Unvertrauten“ eröffnet uns neue Perspektiven und befähigt uns schließlich auch zu einer tieferen Reflexion und Bewusstwerdung über die eigene Kultur.
Was erwartet mich?
Der Kurs „Interkulturalität, Ethik und Recht“ widmet sich schwerpunktmäßig den Bedeutungsdimensionen und spezifischen Wechselwirkungen jener Konzepte. Er möchte somit den Grundstein zum kulturellen Perspektivwechsel bzw. zur Entwicklung interkultureller Kompetenzen legen. Die Auseinandersetzung mit Menschenrechten und kulturellen Werten (theoretisch und praxisbezogen im Kontext interkultureller Rechtsfälle) nimmt dabei einen wesentlichen Teil ein.
Als Kursteilnehmer erwartet Sie eine abwechslungsreiche Mischung aus kognitiven und erfahrungsorientierten Lerninhalten. Die Basis bildet das Lernen mit Karteikarten, die Ihnen schrittweise juristische und kulturwissenschaftliche Grundlagenkenntnisse vermitteln und zudem auch das analytische Denken schulen. Kreative Methoden, wie Mindmapping und Brainstorming, kommen dabei nicht zu kurz. In Ergänzung zu den Karteikarten unterstützen Lesetexte, Video-Clips, sowie kurze Übungen und Lernkontrollen die Verinnerlichung der Lerninhalte.
FAQ – Häufig gestellte Fragen zum Kurs:
Für wen wurde der Kurs konzipiert? Werden bestimmte Vorkenntnisse vorausgesetzt?
Der Kurs wurde für Studierende aller Fachbereiche konzipiert und setzt keine besonderen Vorkenntnisse voraus. Da die spezifischen Wechselwirkungen zwischen den Konzepten Kultur und Recht den Schwerpunkt bilden, ist der Kurs insbesondere für Studierende der Rechts- und Kulturwissenschaften / Fremdsprachenphilologien eine sehr sinnvolle Ergänzung zu regulären Lehrveranstaltungen. Für Studierende aller anderen Fächer bedeutet er einen doppelten Gewinn: Eine Einführung ins Recht und in die Kulturwissenschaften.
Wer steht hinter diesem E-Learning-Kurs? Wie ist er entstanden?
Der E-Learning-Kurs ist das Ergebnis einer interdisziplinären Zusammenarbeit drei junger Nachwuchswissenschaftler der Uni Würzburg, deren Kompetenzbereiche in den Rechts- und Kulturwissenschaften, sowie der Südasienkunde, Pädagogik und Anglistik zu verorten sind.
Zum Kurs auf vhb.org.
“eGovernment in Europe, Germany and Greece” - Workshop in Thessaloniki
Unter dem Titel „eGovernment in Europe, Germany and Greece“ trafen sich vom 21.-27.Oktober 2015 griechische und deutsche Wissenschaftler und Studierende in Thessaloniki zu Vorträgen und Diskussion. Die Tagung des diesjährigen DAAD-Workshops fand in den Räumen der Rechtsanwaltskammer von Thessaloniki statt. Nach einem einleitenden Vortrag von Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf (Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtstheorie, Informationsrecht und Rechtsinformatik, Universität Würzburg) referierte die Lehrstuhlinhaberin für Strafrecht und Kriminologie der Partneruniversität Thessaloniki, Prof. Dr. Maria Kaiafa, über rechtliche Fragen zu Angriffen auf Informationssysteme. Auch von Vertretern der Universitäten der Ägäis, Hamburg und Makedonien gab es Beiträge zum Thema.
Einen interessanten Einblick in die praktische Umsetzung von eGovernment bot die Projektleiterin Julia Kloiber von „Code for Germany“, einer Initiative, die sich die Verbesserung von Transparenz und Open Data mithilfe von informierenden Apps für Bürger und Verwaltung als Ziel gesetzt hat.
Der letzte Workshop-Tag unter dem Motto „Students Day“ bot Studenten und Doktoranden die Plattform für eigene Vorträge.
Die letzten zwei Tage standen ganz im Zeichen des kulturellen Austauschs zwischen Griechenland und Deutschland und wurden von den Teilnehmern zum Kennenlernen von Land und Leuten genutzt.
Ein interkulturelles Lehrprojekt zur Vermittlung deutschen Rechts in der Türkei
Seit dem Sommersemester 2010 bot der Lehrstuhl von Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf regelmäßig Lehrveranstaltungen zum deutschen Recht an der Bahçeşehir Universität in Istanbul an. Ziel des Projekts war es, den wissenschaftlichen Austausch zwischen deutschen und türkischen Studierenden zu fördern sowie internationale rechtswissenschaftliche Kooperationen auszubauen. Die Initiative ging auf Prof. Hilgendorf und Prof. Dr. Feridun Yenisey zurück, der bereits 2008 bei einer Tagung in Würzburg zu Gast gewesen war – ein Kontakt, aus dem sich diese nachhaltige Zusammenarbeit entwickelte.
Im Rahmen der sogenannten „Würzburger Wochen“ wurden kompakte Einführungskurse in zentrale Bereiche des deutschen Rechts angeboten. Die Veranstaltungen richteten sich an Studierende ebenso wie an Praktikerinnen und Praktiker, etwa Anwälte oder Polizeivertreter. Ergänzt wurden die Vorträge durch praxisnahe Fallbesprechungen in Kleingruppen, die das theoretische Wissen vertieften und zur Diskussion anregten.
1. Würzburger Woche (26.–30. April 2010)
Den Auftakt bildeten Kurse zum deutschen Staatsrecht, Strafrecht und Zivilrecht (mit Schwerpunkten auf Schuldrecht, Sachenrecht sowie Familien- und Erbrecht). Rund 70 Teilnehmende – darunter Studierende verschiedener Istanbuler Universitäten sowie Praktiker – nahmen an der Woche teil. Die intensive Diskussion im Anschluss an die Vorträge zeigte das große Interesse am deutschen Rechtssystem.
2. Würzburger Woche (18.–22. April 2011)
Die zweite Würzburger Woche behandelte vertiefend weitere Rechtsgebiete: Kaufrecht, Arbeitsrecht, Verwaltungsrecht, Grundrechte sowie das Strafprozessrecht. Neben den Vorlesungen fand Kleingruppenunterricht statt, in dem anhand von Beispielsfällen Normen und juristische Argumentation eingeübt wurden.
4. Deutsch-Türkisches Symposium
Fünf Jahre Türkisches Strafgesetzbuch

24. - 27.06.2010
Würzburg, Alte Universität, Hörsaal II
Fünf Jahre Türkisches Strafgesetzbuch
Die Tagung hat den deutsch-türkischen Austausch strafrechtswissenschaftlicher Erkenntnisse zum Ziel, insbesondere die Untersuchung der Einflüsse des kontinentaleuropäischen Rechts auf das türkische Strafgesetzbuch im Lichte der umfassenden türkischen Strafrechtsreform von 2005. Die besondere Relevanz dieses Unternehmens rührt daher, dass wesentliche Teile des deutschen Strafrechts (speziell des Allgemeinen Teils des deutschen Strafgesetzbuches) in das türkische Strafgesetzbuch von 2005 übernommen wurden. Das Interesse der türkischen Strafrechtswissenschaft an den Grundfragen und -Problemen der deutschen Strafrechtswissenschaft ist daher immens. Für die letztere erschließt sich dabei zum einen die attraktive Möglichkeit eines weitreichenden Wissensexports. Zum anderen erhält sie Gelegenheit, die eigenen erprobten Konzepte in einen neuen Kontext zu stellen und dadurch ihren Blickwinkel auf sie um eine interessante Perspektive zu erweitern. Schließlich bietet die Tagung ein Forum zum kommunikativen Austausch, der dem interkulturellen Verständnis beider Gesellschaften förderlich sein wird.
Der Tagung liegt folgendes Konzept zugrunde: Ein türkischer Teilnehmer referiert über einen relativ genau abgegrenzten Komplex aus dem neuen türkischen Strafrecht (z.B. Kausalität, Notwehr usw.), wobei gerade auch Probleme angesprochen und Rezeptionsschwierigkeiten thematisiert werden. Das Koreferat hält ein deutscher Kollege, der die Fragestellung aus der Perspektive des deutschen Strafrechts aufgreift, Bezüge herstellt und Lösungsvorschläge formuliert. In der anschließenden Diskussion können so gemeinsame Positionen gefunden, verschiedene Herangehensweisen kennen gelernt und erörtert werden.
Vorläufiges Tagungsprogramm
24. Juni 2010 | |
25. Juni 2010 | |
09.15 Uhr | Eröffnung Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf / Dr. Silvia Tellenbach |
10.00 Uhr | Kausalzusammenhänge im türkischen Strafrecht Prof. Dr. Yener Ünver (Universität Yeditepe Istanbul) |
11.00 Uhr | KAFFEEPAUSE |
11.15 Uhr | Beleidigung im türkischen Strafrecht Prof. Dr. Hakan Hakeri (Universität Ondokuz Mayis Samsun) |
12.15 Uhr | Sicherungsmaßnahmen im türkischen Strafgesetzbuch (Art. 50-60 t-StGB) Prof. Dr. Emin Artuk (Universität Marmara Istanbul)Koreferent: Prof. Dr. Bernd Heinrich (HU Berlin) |
13.15 Uhr | MITTAGSPAUSE |
15.00 Uhr | Freiheitsberaubung im türkischen Strafrecht (Art. 109 t-StGB) PD Dr. Özlem Yenerer Cakmut (Universität Marmara Istanbul)Koreferent: Prof. Dr. Walter Perron (Universität Freiburg)
|
16.00 Uhr | Straftaten gegen das Privatleben und die Intimsphäre (Art. 132-140 t-StGB) Prof. Dr. Bahri Öztürk (Universität Kültür Istanbul)Koreferent: Prof. Dr. Dr. Kristian Kühl (Universität Tübingen) |
17.00 Uhr | STADTFÜHRUNG |
19.00 Uhr | GEMEINSAMES ABENDESSEN |
26. Juni 2010 | |
09.15 Uhr | Irrtum im türkischen Strafgesetzbuch (Art. 30 t-StGB) Doz. Dr. Baris Erman (Universität Bilgi Istanbul) |
10.15 Uhr | Fahrlässigkeit im türkischen Strafgesetzbuch (Art. 22 t-StGB) Gülsün Ayhan Aygörmez (zur Zeit an der Universität Bielefeld) |
11.15 Uhr | KAFFEEPAUSE |
11.45 Uhr | Die Strafaussetzung zur Bewährung im türkischen Strafrecht Prof. Dr. Nur Centel (Universität Marmara Istanbul) |
12.45 Uhr | MITTAGSPAUSE |
14.30 Uhr | Verbreitung pornographischer Schriften im türkischen Strafrecht (Art. 226 t-StGB) Prof. Dr. Veli Özer Özbek (Universität Dokuz Eylül) |
| 15.30 Uhr | ENDE DES ZWEITEN TAGUNGSTAGES |
27. Juni 2010 | |
Konzept der Tagung

„Europas Medizinforschung ist nicht gut genug, die medizinische Versorgung ist zu teuer und unsere Pharmaindustrie in der Welt nicht wettbewerbsfähig“; so der überaus deutliche Befund von Prof. Liselotte Hojgaard, Vorsitzende des Europäischen Medizinforschungsrats (EMRC). Das aktuelle Weißbuch „Künftige Strategie für die Medizinforschung in Europa“ zeigt, dass die medizinische Forschung in Europa im internationalen Wettbewerb weit zurück liegt und dringend Maßnahmen zu ihrer Verbesserung ergriffen werden müssen.
Dazu gehören eine intensivere Forschungsförderung, institutionelle Stärkung – eben unter anderem durch den neu gegründeten EMRC – sowie eine Entschlackung der die Forschung behindernden Europäischen Regelungen. Ein nicht unwesentliches Problem für die Forschung sind gerade die vielfältigen und teils widersprüchlichen rechtlichen Regelungsebenen. Die Notwendigkeit, verschiedene Kulturen auf einen gemeinsamen rechtlichen Nenner zu bringen, verursacht Konflikte und verlangsamt die Forschung. So wehren sich etwa Deutschland oder Italien gegen die freizügige Haltung Europas hinsichtlich der Embryonen- und Stammzellforschung, und es gibt erhebliche Uneinigkeit hinsichtlich der Förderungswürdigkeit gentechnologischer Forschungsprojekte, der Art und Weise der Finanzierung medizinischer Forschung, oder auch der erwünschten Ergebnisse.
Diese Uneinigkeit kann nicht einfach ignoriert oder wegreguliert werden, denn sie hat ihren guten Grund in den nationalen Kulturen und Moralvorstellungen. Die Idee „Europa“ basiert auch auf dem Respekt vor diesen Unterschieden und dem Versuch, sie einzubinden. Die einzelnen Staaten sollten deshalb auch weiterhin entscheiden können, wie sie die Freiheit der Forschung und sich die aus ihr ergebenden Vorteile einerseits mit möglicherweise drohenden Tabuverletzungen, begrenzten finanziellen Ressourcen oder gesellschaftlichen Bedrohtheitsgefühlen andererseits abwägen wollen. Für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Medizinforschung ist es jedenfalls dringend erforderlich, die Ressourcen und Fähigkeiten aus ganz Europa zu bündeln und gemeinsame Strategien zu entwickeln. Es ist also ein Kompromiss zu finden zwischen den berechtigten nationalen Eigenheiten und den nicht weniger berechtigten europäischen Gesamtinteressen. Ein erster Schritt in diese Richtung ist die Sichtung und Analyse der problematischen Situationen, ihrer theoretischen Hintergründe und die Erarbeitung möglicher Lösungswege.
Programm
19. Juni 2009 | |
12.00-12.30 Uhr | Begrüßung |
12.30-13.30 Uhr | Biomedizinische Forschung in Europa und die rechtlichen Vorgaben: Hilfe oder Hemmnis? Prof. Dr. Martin Lohse, Rudolf-Virchow-Zentrum, Universität Würzburg |
13.30-14.30 Uhr | Unterschiedliche (Rechts-)Kulturen – einheitliche Forschung? Prof. Dr. Rudolf Streinz, Universität München |
14.30-15.30 Uhr | Der Verweis auf „ethische Grundprinzipien“ als europäisches Embryonenschutzkonzept? Prof. Dr. Lothar Michael, Universität Düsseldorf |
15.30-16.00 Uhr | KAFFEEPAUSE |
16.00-17.00 Uhr | Das siebte Forschungsrahmenprogramm und seine Probleme Prof. Dr. Brigitte Tag, Universität Zürich |
17.00-18.00 Uhr | Der Status der Forschung in der europäischen Grundrechtscharta und der EMRK Prof. Dr. Carsten Nowak, Universität Siegen |
20. Juni 2009 | |
08.30-09.30 Uhr | Beschränkung der medizinischen Forschung durch Strafrecht? Prof. Dr. Christian Schwarzenegger, Universität Zürich |
09.30-10.30 Uhr | Die Forschung an Nicht-Einwilligungsfähigen als rechtliche Möglichkeit Prof. Dr. Henning Rosenau, Universität Augsburg |
10.30-11.00 Uhr | KAFFEEPAUSE |
11.00-12.00 Uhr | Beschränkung der Forschung durch Europarecht am Beispiel der Gentechnologie Prof. Dr. Winfried Kluth, Universität Halle-Wittenberg |
12.00-13.00 Uhr | Können europäische Vorgaben ein Tätigwerden des nationalen Strafgesetzgebers erzwingen? Prof. Dr. Gerhard Dannecker, Universität Heidelberg |
13.00-13.30 Uhr | MITTAGSPAUSE |
13.30-15.00 Uhr | PODIUMSDISKUSSION: Forschung und ihre moralischen und rechtlichen Grenzen: Im Zweifel für die Freiheit? Im Zweifel für die Patienten? Im Zweifel für den Gewinn? Prof. Dr. Jörg Hacker (Präsident des Robert-Koch-Instituts) Prof. Dr. Eckhard Pache (Universität Würzburg) Prof. Dr. Yener Ünver (Yeditepe Universität, Türkei) Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf (Universität Würzburg) |
zum Download
Biotechnologische Herausforderungen und rechtliche Reaktionsmöglichkeiten
Vorstudien zu einer Gesetzgebungslehre der Humanbiotechnologie.
Im Rahmen des Förderschwerpunktes „Ethische, Rechtliche und Soziale Aspekte der Modernen Lebenswissenschaften und der Biotechnologie“ (ELSA) fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung das auf zweieinhalb Jahre angelegte Projekt „Biotechnologische Herausforderungen und rechtliche Reaktionsmöglichkeiten. Vorstudien zu einer Gesetzgebungslehre der Humanbiotechnologie“.
Das Forschungsprojekt hat zum Ziel, eine Gesetzgebungslehre für den Bereich der Biotechnologie zu entwickeln. Es soll untersucht werden, welche Faktoren ausschlaggebend für erfolgreiche Regelungen in diesem Bereich sind und ob es Zusammenhänge zwischen bestimmten Eigenheiten eines Regelungsgebietes und bestimmten staatlichen Regelungsformen gibt.
Dementsprechend sollen vor allem folgende Fragen geklärt und beantwortet werden: Welche rechtlichen Möglichkeiten besitzt der Staat, um auf neue biotechnologische Herausforderungen zu reagieren? Welche Faktoren sind ausschlaggebend dafür, dass eine Regelung erfolgreich ist? Gibt es einen Zusammenhang zwischen bestimmten Eigenheiten eines Regelungsgebiets und bestimmten staatlichen Reaktionsformen? Sollte es einen solchen Zusammenhang geben?
Ziel ist es, dem Gesetzgeber klare und nachprüfbare Kriterien an die Hand zu geben, welche Regelungsform für welche Regelungsmaterie am geeignetsten ist. Dabei sind die besonderen Probleme des Biotechnologierechts zu berücksichtigen. Neben rasantem Erkenntnisfortschritt und besonderem Gefährdungspotential für grundrechtlich geschützte Rechtsgüter stellen sich in besonderem Maße ethische Fragen, die eine Konsensbildung im Rechtssetzungsprozess häufig erschweren.
Die Untersuchung ist rechtspolitischer und gesetzgebungstheoretischer Art. Es soll auf bestehenden Arbeiten zur Gesetzgebungslehre, insbesondere Arbeiten zur Rechtsformenwahl sowie zur Risikoregulierung aufgebaut werden. Auch soll eine „Fehleranalyse“ bereits ergangener Rechtssetzung stattfinden.